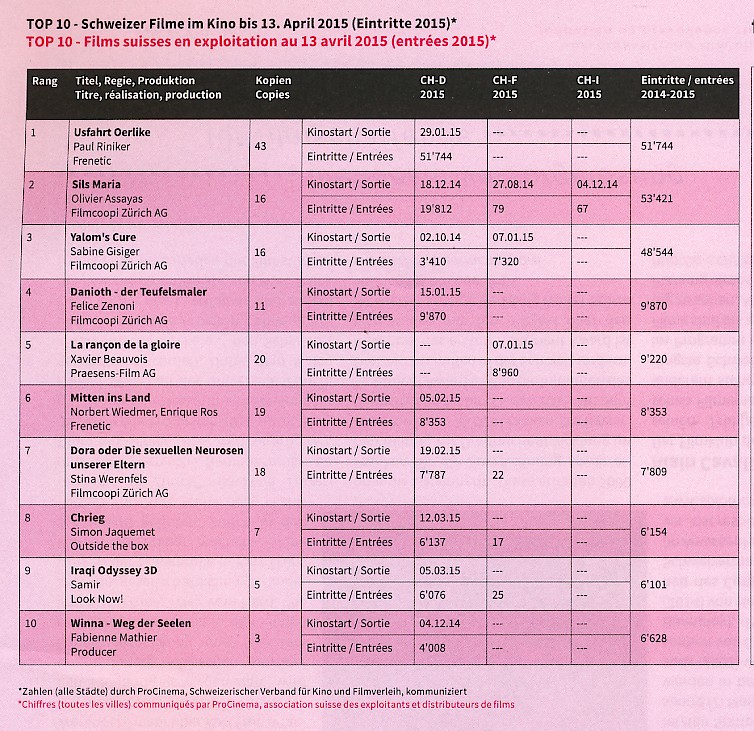Heinrich Danioth, 1896 in Altdorf geboren und 1953 in Flüelen gestorben, ist der bedeutendste Innerschweizer Künstler und einer der herausragenden Schweizer Maler des 20. Jahrhunderts. Alle kennen seinen roten Teufel an der Felswand in der Schöllenen. Trotzdem ist der Urner heute etwas in Vergessenheit geraten. Zu unrecht, wie der aktuelle Kino-Dokumentarfilm „Danioth – der Teufelsmaler“ von Felice Zenoni beweist.
Der 90-Minuten-Film zeigt einen „Best of“-Querschnitt durch Danioths vielschichtiges Werk als Maler. Rückgrat der biografisch angelegten Handlung sind Tagebuch-Notizen und Briefauszüge. Der in Uri aufgewachsene Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart leiht dem vor über 60 Jahren verstorbenen Künstler seine Stimme. Bergauf, bergab sucht die Kamera quer durch den Kanton Uri nach Spuren; ergänzt durch Archivfilme und eingerahmt von persönlichen Erinnerungen einer ganzen Reihe überraschender Zeitzeugen. Darunter die Töchter des Künstlers, Madeleine und Cilli Danioth. Der bekannte Publizist Karl Lüönd ist bei Heinrich Danioth nahe dran gewesen. In Flüelen aufgewachsen, erzählt er, wie er sich „wie-n-es Müsli“ ins Atelier des Meisters hat schleichen können. Auch Hans Erni, Danioths häufigster Konkurrent bei öffentlichen Aufträgen, erinnert sich. Beim Wettbewerb zur Gestaltung der Fassade des Bundesbriefmuseums in Schwyz treffen die beiden 1936 aufeinander. Prämiert und ausgeführt wird Danioths Entwurf. Erni landet auf Platz 5.
Eine eigentliche Hauptrolle im Film spielen die Landschaften des Kantons Uri. Obwohl Danioth nicht nur „der Urner Maler“ sein wollte, bleiben Berge, Täler und das Wasser die nachhaltigsten Quellen seiner Inspiration. Die Kamera macht sich die Optik des Künstlers zu eigen, dringt ein in eine Welt voller Mysterien, zwischen Licht und Schatten. Der Künstler selbst hat es einmal so beschrieben: „Meine Heimat ist, fürwahr, Prunkkammer Gottes und Irrgarten des Teufels, zu gleichen Teilen.“
Vor allem in der zweiten Lebenshälfte wird aus dem Maler auch ein Schriftsteller. Er schreibt Hörspiele, Prosa, Lyrik und Theaterstücke. Der Film wirft einen Blick auf Danioths engagierte Mitarbeit bei der Satirezeitschrift „Nebelspalter“. Mit bissigen Kommentaren und Karikaturen persifliert er die Vorgänge in Nazi-Deutschland. Selbst dann noch, als die Angst vor der deutschen Kriegsmaschine den Schweizer Alltag überschattet. „Mein Vater hätte sich irgendwo in den Bergen verstecken müssen, wenn sie gekommen wären“, stellt Tochter Madeleine heute lakonisch fest, „seine Sachen hatte er gepackt. Der Rucksack stand immer bereit.“ Dass ausgerechnet seine frechen Hitler-Karikaturen in den Kriegsjahren von der bundesrätlichen Pressezensur „übersehen“ worden sind, grenzt an ein Wunder.
Falls es nicht doch mit Absicht geschehen sein sollte. Der damalige Zuger Bundesrat Philipp Etter war ein Bewunderer Danioths und in den Kriegsjahren der starke Mann im Rat.
Danioths Leben als Erwachsener spielt sich hauptsächlich während und zwischen den beiden Weltkriegen ab. Auch wirtschaftlich ein schwieriger Zeitabschnitt. Zwischen 1914 und 1945 stehen die Grenzen nur sehr eingeschränkt offen und die Menschen haben andere Sorgen, als Kunst zu kaufen. Die Krise der 30er-Jahre trifft Kunstschaffende deshalb besonders hart.
Dem Urner Filmautor Felice Zenoni ist es gelungen, das von Selbstzweifeln und materiellen Nöten gezeichnete Künstlerleben wirklichkeitsnah abzubilden. Danioth als eigensinniger Grenzgänger zwischen Malerei und Wort. Danioth als Mensch und Familienvater.
Die Tonspur des Films geht von „Zogä-n am Bogä“ aus, jener Melodie, die heute auch „Urner Nationalhymne“ genannt wird. Als das Lied in den 20er-Jahren aus der Taufe gehoben wird, ist Heinrich Danioth mit seinem Akkordeon aktiv dabei. Heute illustriert nun die junge Schweizer Musikerin Fatima Dunn die Welt des Künstlers mit ihren Klangbildern.
Musiker: Matteo Schenardi, Livio Baldelli, Benno Muheim.